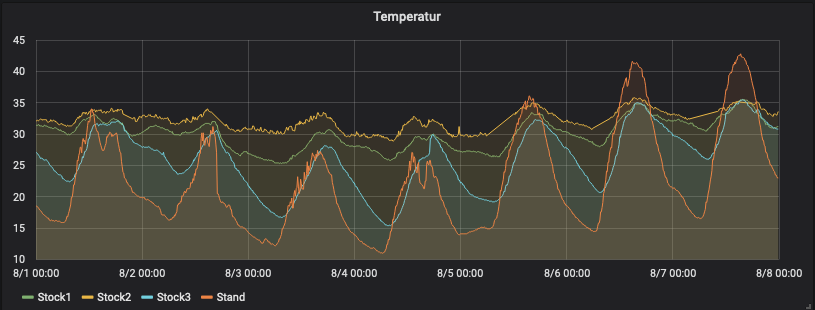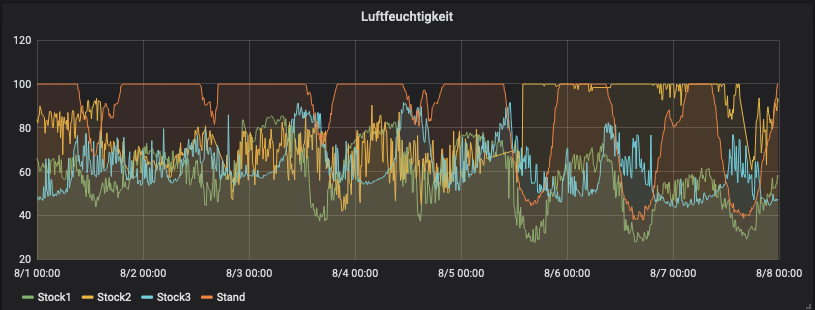Es ist 2025 und wir nähern uns dem Bio-Honig.
Nein, wir haben noch keinen Bio-Honig, aber fast. Unsere Bienen leben nicht nur ganzjährig in Reetbeuten, sie sammeln nun auch Honig in Holzbeuten.

Nach der EU-Ökobasisverordnung – Anhang II – Teil II: „Vorschriften für die Tierproduktion“ – 1.9.6. „Für Bienen“ gilt für Bio-Honige:
| Nr. Überschrift | Kriterium | Unsere Bienen |
|---|---|---|
| 1.9.6.1. Herkunft der Tiere | Bei der Bienenzucht ist Apis mellifera und ihren lokalen Ökotypen der Vorzug zu geben. | Wir züchten nicht, sondern freuen uns über jede natürlich entstandene Königin. |
| 1.9.6.2. Ernährung | a) Am Ende der Produktionssaison muss für die Überwinterung der Bienen genügend Honig und Pollen in den Bienenstöcken verbleiben; | Wir entnehmen grundsätzlich gar nichts aus dem Brutraum, d.h. alles, was die Damen im Brutraum haben, behalten sie. |
| b) das Füttern von Bienenvölkern ist nur zulässig, wenn das Überleben des Volks klimabedingt gefährdet ist. In diesem Falle dürfen Bienenvölker mit ökologischem/biologischem Honig, ökologischem/biologischem Pollen, ökologischen/biologischen Zuckersirupen oder ökologischem/biologischem Zucker gefüttert werden. | Wir füttern mit Futterteig, damit der Brutraum nicht binnen kurzer Zeit mit Futter überschwemmt wird und noch Platz für die Winterbienenbrut bleibt. | |
| 1.9.6.3. Tiergesundheit | a) Um Rahmen, Bienenstöcke und Waben insbesondere vor Schädlingen zu schützen, dürfen nur Rodentizide (die in Fallen verwendet werden) und geeignete Erzeugnisse und Stoffe verwendet werden, die nach den Artikeln 9 und 24 für die Verwendung in der ökologischen/biologischen Produktion zugelassen sind; | Wir verwenden nur Essigsäure zur Bekämpfung / Fernhaltung der Wachsmotte bei der Lagerung von gebrauchten Brutwaben. |
| b) physikalische Behandlungen zur Desinfektion von Beuten (wie Dampf oder Abflammen) sind gestattet; | Haben wir bisher nicht gemacht. | |
| c) männliche Brut darf nur vernichtet werden, um den Befall mit Varroa destructor einzudämmen; | Wir entnehmen keine männliche Brut. | |
| d) wenn die Bienenvölker trotz aller Vorbeugungsmaßnahmen erkranken oder befallen sind, sind sie unverzüglich zu behandeln, und sie können erforderlichenfalls isoliert aufgestellt werden; | Hatten wir bisher nicht, aber ja, selbstverständlich. | |
| e) bei Befall mit Varroa destructor dürfen Ameisensäure, Milchsäure, Essigsäure und Oxalsäure sowie Menthol, Thymol, Eukalyptol oder Kampfer verwendet werden; | Wir verwenden ausschließlich Oxalsäure (träufeln) und Thymol (aufgelegt in Streifen). | |
| f) werden chemisch-synthetische allopathische Mittel, einschließlich Antibiotika, verabreicht, […]. | Nicht bei uns. | |
| 1.9.6.4. Tierschutz | a) Die Vernichtung von Bienen in den Waben als Methode zur Ernte der Imkereierzeugnisse ist untersagt | Wir ernten mit Bienenflucht und Abfegen. |
| b) Verstümmelungen wie das Beschneiden der Flügel von Weiseln sind verboten. | Königinnen sollen fliegen. Schwärmen ist cool. | |
| 1.9.6.5. Unterbringung und Haltungspraktiken | a), b) und c) Standort der Bienen muss […] | Bei uns stehen die Bienen im Dorf. |
| d) die Beuten und das Imkereizubehör müssen grundsätzlich aus natürlichen Materialien bestehen, bei denen keine Gefahr besteht, dass Umwelt oder Imkereierzeugnisse kontaminiert werden; | Wir nutzen Holz aus dem Baumarkt, haben Reet vom Dachdecker ein Dorf weiter geholt und Rähmchen usw. aus dem Bienenladen besorgt. | |
| e) Bienenwachs für neue Mittelwände muss aus ökologischen/biologischen Produktionseinheiten stammen; | Wir haben dieses Jahr unseren eigenen Wachskreislauf gestartet. | |
| f) in den Bienenstöcken dürfen nur natürliche Produkte wie Propolis, Wachs und Pflanzenöle verwendet werden; | Wir verwenden da gar nichts. | |
| g) während der Honiggewinnung ist die Verwendung chemisch-synthetischer Repellents untersagt; | Selbstverständlich. | |
| h) Waben, die Brut enthalten, dürfen nicht zur Honiggewinnung verwendet werden; | Wir imkern mit Absperrgitter zwischen Brut- und Honigraum. Außerdem entnehmen wir dem Brutraum nichts. | |
| i) die Bienenhaltung gilt nicht als ökologisch/biologisch, wenn sie in Regionen oder Gebieten stattfindet, die von den Mitgliedstaaten als Regionen oder Gebiete ausgewiesen wurden, in denen die Bienenhaltung nach den Vorschriften für die ökologische/biologische Produktion nicht praktikabel ist. | Keine Ahnung, ob das für Holm gilt. Wahrscheinlich nicht. | |
| 1.9.6.6. Pflicht zur Führung von Aufzeichnungen | […] Alle angewendeten Maßnahmen müssen in das Bienenstockverzeichnis eingetragen werden, einschließlich der Vorgänge der Entnahme der Honigwaben und der Honigschleuderung. Die Menge und die Zeitpunkte der Honiggewinnung müssen ebenfalls aufgezeichnet werden. | Wir dokumentieren alle Behandlungen digital und dokumentieren auch Menge und Zeitpunkt der Honiggewinnung, wenn auch nicht alles an einem digitalen Ort. |
An den gefetteten Kommentaren zu unseren Bienen wird deutlich: Wir sind nah dran.
- Da wir nicht wandern, sondern die Bienen im Dorf stehen, haben wir auf den Standort keinen Einfluss.
- Wir vertrauen unseren Lieferanten bzw. den Läden, wo wir unser Material und Imkerzubehör kaufen. Ob da immer keine Gefahr der Kontaminierung besteht? Wahrscheinlich, aber garantieren können wir das nicht.
- Wir füttern mit Futterteig, damit der Brutraum nicht binnen kurzer Zeit mit Futter überschwemmt wird und noch Platz für die Winterbienenbrut bleibt. Leider ist Futterteig nicht explizit in der Aufzählung des Erlaubten enthalten (siehe oben 1.9.6.2. b)).
Hier unser Fast-Bio-Honig aus 2025: